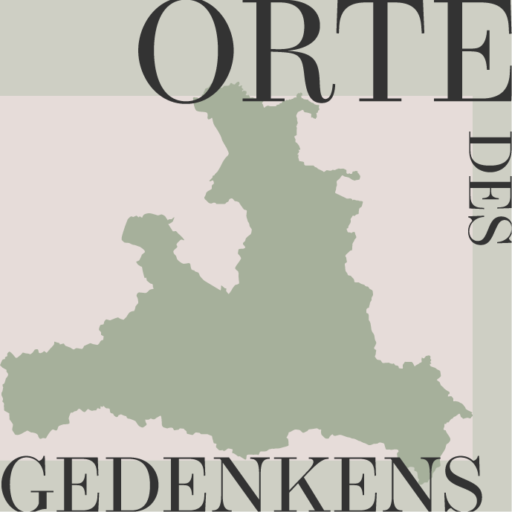Saalfelden
Franz Dillinger (1897 – 1945)
Franz Dillinger wurde am 1. April 1897 als uneheliches Kind von Elisabeth Dillinger und Johann Kerschbaumer geboren. Tags darauf wurde er in der katholischen Kirche in Maria Alm getauft. In derselben Pfarre heiratete er am 17. Mai 1920 die drei Jahre jüngere Maria Machreich, gebürtig am 25. Juli 1900 in Zell am See. Die beiden wohnten in der Bahnhofsstraße 221 in Saalfelden, was vermutlich mit Dillingers Beruf als Eisenbahner zusammenhing. Am 22. Jänner 1927 reichte Franz Dillinger eine Meldung bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See ein, in der er seinen Austritt aus der katholischen Kirche bekanntgab, das wurde am 9. Februar 1927 umgesetzt, er galt ab da als konfessionslos. Ob seine Ehefrau dasselbe tat, ist den Quellen nicht zu entnehmen.
Mit dem aufkommenden Nationalsozialismus formierten sich in der KPÖ (Kommunistische Partei Österreichs) Salzburgs etliche Widerstandsgruppen, die jedoch im Februar 1942 in einer Verhaftungswelle vollkommen zerschlagen wurden. 1940 hatte Josef Scherleitner aus Lend begonnen ein Netz von Widerständigen im Pinzgau zu formieren, konkret zuständig für Saalfelden war Georg Wörgötter, der aufgrund seines Widerstandes gegen den Austrofaschismus bereits amtskundig war. Wörgötter arbeitete bei der Bahn und warb einige seiner Kollegen für sein Vorhaben an, darunter auch Franz Dillinger, der zusätzlich seine Kollegen und gleichzeitige Nachbarn Ludwig Thurner und Johann Kröll anwarb und von diesen regelmäßige Mitgliedsbeiträge in der Höhe von 1 RM (Reichsmark) einzog.
1942 gemeinsam mit Karl Reinthaler verhaftet
Im Frühjahr 1942 führte die Gestapo eine groß angelegte Verhaftungswelle gegen politisch Widerständige durch. Ende Februar desselben Jahres wurden die Saalfeldner Georg Wörgötter, Johann Kröll, Karl Ettel, Paul Lürzer, Ludwig Thurner, Franz Dillinger, Anton Wimmer, Karl Reinthaler, Lothar Pointner sowie Peter Mitteregger aus Kaprun festgenommen. Die Mehrheit der Verhafteten war bei der Eisenbahn beschäftigt. Der Vorwurf lautete auf Mitgliedschaft in einer illegalen kommunistischen Organisation und insbesondere Georg Wörgötter wurde die Leitung der KP Saalfelden zur Last gelegt.
Am 8. Dezember 1942 kam es zum Prozess gegen Dillinger im Salzburger Justizpalast, Saal 144. Wörgötter, Lürzer und Thurner wurden dort vom Oberlandesgericht Wien (OLG) wegen Hochverrats zu jeweils 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Der Initiator Josef Scherleitner erhielt die härteste Strafe und wurde am 30. April 1943 in München-Stadlheim hingerichtet. Dillinger erhielt eine Strafe von neun Jahren Zuchthaus; Wimmer, Pointner, Reinthaler, Ettel und Kröll jeweils sechs Jahre, Mitteregger fünf Jahre.
Verstarb im Zuchthaus Augsburg
Im Zuge der vorangegangenen Verhöre hatte Franz Dillinger wiederholt abgestritten, dieser kommunistischen Vereinigung angehört zu haben, seines Wissens habe es sich um eine „gewerkschaftliche Organisation zur Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Teilnehmer“ gehandelt. Von der mehrköpfigen Gruppe gestanden nur Pointner, Reinthaler und Mitteregger, Mitglieder in der Kommunistischen Partei gewesen zu sein, jene drei erhielten auch die niedrigsten Strafen. Karl Reinthaler gab in einem später geführten Interview an, dass es nach seinem Empfinden ein Prozess gewesen war, der hauptsächlich dazu diente, ein Exempel zu statuieren, denn es war damals bei der Gestapo durchaus üblich gewesen, Menschen ohne jegliche Gerichtsverhandlungen und Prozesse hinzurichten oder in Zuchthäuser und Konzentrationslager zu bringen.
Laut Unterlagen der Opferfürsorge befanden sich Lürzer, Wimmer, Pointner, Wörgötter und Reinthaler von Februar 1942 bis Kriegsende in Haft. Johann Kröll war von März 1942 bis Mai 1945 im Konzentrationslager Mauthausen inhaftiert.
Anfänglich kam Franz Dillinger in das Zuchthaus Augsburg, von wo er Ende Jänner 1943 in das Zuchthaus Kaisheim in Schwaben überstellt wurde. Dort verstarb er am 3. Februar 1945 frühmorgens, angeblich infolge eines schlechten Gesundheitszustandes.
In den Akten findet sich vom 10. Juli 1947 ein Eintrag, dass die Witwe Maria Dillinger einen Antrag auf Opferfürsorge stellte.
Autor*innen: Laura Manzl, Heidi Stefer, Marelie Höller, Mouaz Hameedi
Quellen und Literatur:
DÖW, 17965.
Sabine Aschauer-Smolik/Alexander Neunherz, Karl Reinthaler. Dagegenhalten. Eine Lebensgeschichte zwischen Brüchen und Kontinuitäten in der Provinz, Innsbruck 2004.
Sabine Aschauer-Smolik, Saalfelden unterm Hakenkreuz
Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes, Widerstand und Verfolgung in Salzburg 1934–1945. Eine Dokumentation, Bd. 1, Wien 1991.
Rudolf Leo, Der Pinzgau unterm Hakenkreuz. Diktatur in der Provinz, Salzburg/Wien 2013.