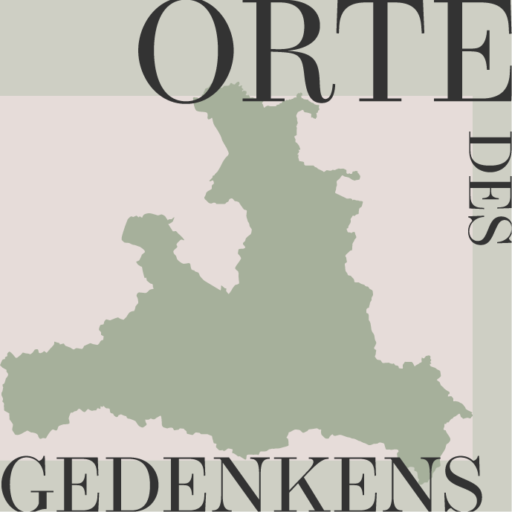Saalfelden
Albert Wieser (1887 – 1942)
Albert Wieser wurde am 27. März 1887 in Mittersill geboren und war von Beruf Gemischtwarenhändler. Er wohnte in Saalfelden (Thor 8) und war verheiratet mit Monika Wieser, geborene Brucker. Gemeinsam hatten sie drei Söhne (Johann, Franz und Albert), von denen einer 1937 erschossen wurde, als er sich einer Verhaftung widersetzte.
Nach dem Besuch der Volksschule in Hollersbach erlernte Wieser das Sägehandwerk und war bis 1914 als Säger tätig. Im Ersten Weltkrieg wurde er an der russischen Front eingesetzt, verwundet und kam 1916 an die italienische Kriegsfront. Danach arbeitete er als Holzarbeiter, Marktfahrer und führte schließlich ein Lebensmittelgeschäft in Saalfelden. Er war Mitglied der sozialdemokratischen Gewerkschaft.
Drei Jahre Zuchthaus wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“
Am 3. Mai 1939 wurde Albert Wieser vom Oberlandesgericht Wien wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zu drei Jahren Zuchthaus und fünf Jahren Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Wieser, der bereits am 3. Oktober 1938 verhaftet worden war, befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits sieben Monate in Untersuchungshaft. Der Grund war eine Äußerung in einem Gasthaus, wonach Menschen im Kriegsfall nicht einrücken sollten, da der Krieg dann sofort beendet wäre. Die Staatsanwaltschaft Salzburg warf ihm zudem vor, kommunistische Ideen zu vertreten. Wieser hingegen gab an, Sozialdemokrat gewesen zu sein. Zudem wurde auch sein Radioapparat beschlagnahmt.
Im Zuge der Ermittlungen wurde ein Notizbuch mit Aufzeichnungen über kommunistische Zeitschriften wie „Rote Woche“, „Arbeiterhelfer“ und „Mahnruf“ gefunden. Er hatte auch Abrechnungen über den Vertrieb dieser Schriften sowie politische Schlagworte und Programmpunkte der NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), SDAP (Sozialdemokratische Arbeiterpartei) und KPÖ (Kommunistische Partei) notiert. Diese enthielten unter anderem Ziele wie die Zerschlagung des staatlichen Machtapparates, die Ausrufung der proletarischen Diktatur und die sofortige Wahl von Sowjets.
Ausländische Radiosender gehört
Wieser hatte regelmäßig ausländische Radiosender wie den Moskauer, Straßburger und Schweizer Sender gehört, auch im Beisein anderer Personen. Er habe sich mehrfach positiv über den Kommunismus und kritisch über die wirtschaftliche Lage in Deutschland geäußert. Zeugenaussagen von mehreren Saalfeldner*innen behaupteten im Verfahren gegen ihn, dass er auch andere von kommunistischen Ideen überzeugen wollte und gesagt habe, Deutschland würde untergehen und der Kommunismus die Macht übernehmen. Während Wieser zugab, ausländische Radiosendungen gehört zu haben, bestritt er die anderen Anschuldigungen.
Nach seiner bereits abgesessenen Zuchthausstrafe im Gefängnis Garsten wurde er von der Gestapo Salzburg – ohne weitere gerichtliche Verhandlung – ins KZ Sachsenhausen und am 11. Oktober 1942 ins KZ Dachau überführt. Hier starb er nur knapp zwei Monate später, am 4. Dezember 1942, angeblich an Herz-Kreislaufversagen infolge einer Lungentuberkulose – die genauen Todesumstände sind wie in vielen anderen Fällen nicht bekannt, da lediglich die Angaben der NS-Täter über sein Ableben Auskunft geben. Sein Leichnam wurde im Lagerkrematorium eingeäschert.
Sohn ohne Verhandlung ins KZ Mauthausen überstellt
Sein Sohn Johann Wieser wurde im Dezember 1940 wegen illegaler Betätigung für die KPÖ, „Vorbereitung zum Hochverrat“ und verbotenem Waffenbesitz von der Gestapo Salzburg verhaftet und im Jänner 1941 ohne Verhandlung in das KZ Mauthausen überstellt. Trotz dieser Verhaftungen blieb ihre Familie offenbar widerständig. So gibt es Hinweise darauf, dass sie dem Deserteur Josef Linsinger Unterschlupf gewährten.
Albert Wieser und seine Frau Monika waren Mitglieder der KPÖ. Nach seinem Tod beantragte Monika Wieser Unterstützung gemäß dem Opferfürsorgegesetz. Ihr Antrag auf Witwen- und Waisenrente wurde genehmigt. Mehrere behördliche Schreiben und Bestätigungen begleiteten das Verfahren.
Autor*innen: Stefanie Steinberger, Amelie Selle, Anahi Videla, Elias Preindl.
Quellen und Literatur:
DÖW, 6792.
DÖW, 18814.
DÖW, 18815.
Sabine Aschauer-Smolik, Saalfelden unterm Hakenkreuz
https://collections.arolsen-archives.org/en/document/10366785
https://collections.arolsen-archives.org/en/document/10781301
https://collections.arolsen-archives.org/en/document/130431239
https://www.zeit-geschichte.com/rlwp/2025/02/16/ns-opfer-im-pinzgau/
Salzburger Tagblatt, 22.7.1946, S. 6.