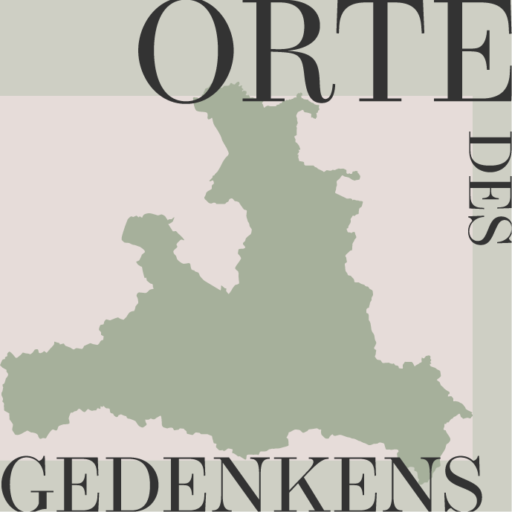Saalfelden
Magnus Scholz (1905–1945)
Magnus Scholz wurde am 4. November 1905 in Saalfelden geboren. Über seine frühe Kindheit ist nur wenig bekannt, doch vieles deutet darauf hin, dass er in einfachen, wahrscheinlich wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen aufwuchs. Scholz arbeitete als Kaminkehrergehilfe, was bereits zu dieser Zeit ein harter und gesundheitlich belastender Beruf war. Die Ausbildung in diesem Handwerk war meist praktisch orientiert und wurde im Rahmen eines Lehrverhältnisses erlernt. Scholz war unverheiratet und katholisch, wie ein Großteil der österreichischen Landbevölkerung zu jener Zeit.
Er gehörte der Arbeiterschaft an, einer sozialen Schicht, die in der Ersten Republik zunehmend politisiert war. In der wirtschaftlich angespannten Zwischenkriegszeit radikalisierten sich viele Arbeiter*innen politisch, insbesondere im Zuge der Weltwirtschaftskrise ab 1929. Auch Scholz sympathisierte mit der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ). Die KPÖ war ab 1933 in Österreich verboten, arbeitete jedoch im Untergrund weiter. Scholz trat der Partei noch vor dem „Anschluss“ an das Deutsche Reich bei. In seiner Heimatgemeinde Saalfelden war er als Mitglied einer kommunistischen Zelle aktiv. Seine Mitgliedschaft belegt ein Ermittlungsbericht der Gendarmerie aus dem Jahr 1949, in dem auch der Name des Zellenleiters Josef Schattner, Trafikant in Saalfelden, genannt wird. Scholz zahlte regelmäßig Mitgliedsbeiträge und galt als überzeugter Kommunist, auch wenn er keine führende Funktion innehatte.
Auf Kritik am NS-Regime folgte Verhaftung
Der „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 markierte eine drastische Wende im Leben vieler politisch aktiver Menschen. Die Nationalsozialisten begannen unverzüglich mit der Verfolgung politischer Gegner*innen. Kommunist*innen, Sozialist*innen und ehemalige Mitglieder republikanischer Organisationen wurden systematisch erfasst, verhaftet und in Konzentrationslager eingewiesen. Bereits in den ersten Monaten nach dem „Anschluss“ wurden Tausende verhaftet. Scholz, der als bekennender Kommunist galt, geriet rasch ins Visier der Gestapo.
Der Vorfall, der zur Verhaftung von Scholz führte, ereignete sich am 1. November 1939. Im Gasthaus „Brücklwirt“ in Saalfelden äußerte er sich in Anwesenheit mehrerer Gäste und eines deutschen Soldaten kritisch über das NS-Regime. Laut späteren Zeugenaussagen habe Scholz gesagt, dass er im Fall einer Einberufung „nicht auf Franzosen schießen“ würde, sondern wisse, „wohin er schießen müsse“. Diese Aussage deutet auf eine klare Ablehnung des Regimes und eine Bereitschaft zum Widerstand hin. Die Äußerung wurde von dem anwesenden Soldaten gemeldet. Drei Tage später, am 4. November 1939, wurde Scholz an seinem 34. Geburtstag von der Gestapo verhaftet.
Acht Monate Haft
Zunächst kam er in das Gefängnis des Amtsgerichts Saalfelden. Am 9. Dezember 1939 wurde er in das Landesgerichtliche Gefangenenhaus Salzburg überstellt. Dort blieb er über mehrere Wochen inhaftiert. Ihm wurde „staatsfeindliche Hetze“ zur Last gelegt – eine Anklage, die auf dem berüchtigten „Heimtückegesetz“ basierte, das 1934 eingeführt worden war. Dieses Gesetz diente dazu, Kritik an Staat und Partei unter Strafe zu stellen, und war eines der zentralen Instrumente des NS-Regimes zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit.
Im Februar 1940 wurde Scholz nach Berlin überstellt. Am 1. Februar 1940 wurde er in das Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis Berlin-Moabit eingeliefert, wo er mehrere Wochen in Untersuchungshaft blieb. Dort wurde er weitgehend in Einzelhaft gehalten, wie der ehemalige Mithäftling, Josef Embacher, in einer eidesstattlichen Erklärung 1954 berichtete. Am 24. Februar 1940 wurde gegen Scholz vor dem Reichskriegsgericht Berlin in der Witzlebenstraße verhandelt. Verteidigt wurde er vom Pflichtverteidiger Rudolf Behse, einem Berliner Rechtsanwalt. Über den genauen Ausgang der Verhandlung liegen bislang keine schriftlichen Quellen vor. Es ist jedoch belegt, dass Scholz nach etwa acht Monaten Haft – ohne zu einer längeren Strafe verurteilt worden zu sein – nach Saalfelden zurückkehrte.
Geschwächt zurück in Saalfelden
Nach seiner Entlassung war Scholz körperlich stark geschwächt. Er konnte seiner Tätigkeit als Kaminkehrergehilfe nicht mehr nachgehen. Seine frühere Arbeitgeberin Maria Rottenspacher beschrieb ihn später als „körperlich gebrochenen Mann“. Er litt an Magenbeschwerden, die laut ärztlichen Berichten auf die Haftbedingungen zurückzuführen waren – insbesondere auf schlechte Ernährung, Isolation und psychische Belastung. Infolge dieser Beschwerden entwickelte sich ein Magengeschwür, das sich trotz medizinischer Behandlung nicht besserte.
Im Jahr 1941 heiratete Scholz Cäcilia Lechner, mit der er zuvor schon länger in einer Beziehung gewesen war. Die Ehe blieb kinderlos. Seine Frau beschrieb ihn in späteren Zeugenaussagen als „ruhigen, freundlichen, aber gezeichneten Menschen“. Trotz aller gesundheitlichen Probleme versuchte Scholz, wieder ein normales Leben zu führen. Er nahm Gelegenheitsarbeiten an, beteiligte sich jedoch nicht mehr an politischen Aktivitäten – wohl auch aus Furcht vor erneuter Verhaftung.
Im Oktober 1945, also wenige Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, verschlechterte sich sein Zustand drastisch. Am 1. Oktober wurde er in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert. Zwei Tage später wurde ein Eingriff am Magen vorgenommen. Die Operation verlief zunächst ohne Komplikationen, doch kurz darauf entwickelte Scholz eine Lungenentzündung, vermutlich infolge seines geschwächten Immunsystems und der schlechten körperlichen Verfassung. Am 22. Oktober 1945 verstarb er an den Folgen der Krankheit, nur wenige Wochen vor seinem 40. Geburtstag.
Antrag auf Entschädigung verzögert
Nach dem Krieg versuchte seine Witwe, Cäcilia Scholz, eine staatliche Entschädigung zu erhalten. Im Rahmen des Entschädigungsverfahrens wurden mehrere Zeug*innen befragt, darunter auch Maria Rottenspacher und Josef Embacher. Diese bestätigten die politischen Umstände der Verhaftung und die gesundheitlichen Folgen der Haft. Besonders wichtig war das ärztliche Gutachten von Dr. Spitzl, dem behandelnden Arzt in Schwarzach, der klar feststellte, dass die Krankheit und der Tod von Magnus Scholz direkt auf die Haftzeit zurückzuführen waren. Dennoch wurde der Antrag auf Entschädigung zunächst mehrfach verzögert und schließlich nur in geringem Umfang anerkannt – ein Schicksal, das viele NS-Opfer in der frühen Nachkriegszeit teilten.
Das Leben von Magnus Scholz ist ein Beispiel für den stillen, individuellen Widerstand gegen das NS-Regime. Scholz war kein berühmter Politiker oder Widerstandskämpfer, sondern ein einfacher Arbeiter, der den Mut hatte, seine Meinung offen zu sagen – ein Akt, der ihn beinahe das Leben gekostet hätte und letztlich zu seinem frühen Tod beitrug. Seine Biografie steht stellvertretend für die viel zu oft vergessenen Opfer, die aus einfachen Verhältnissen kamen und durch ihren Mut zeigten, dass Widerstand nicht immer laut sein muss, um bedeutsam zu sein.
Autor*innen: Sophia Hammerschmid, Ghiath Hameedi, Johanna Haiden
Quellen und Literatur:
DÖW, 15997.
DÖW, 18652.
Stolpersteine Salzburg: Verzeichnis nationalsozialistischer Terroropfer im Bundesland Salzburg