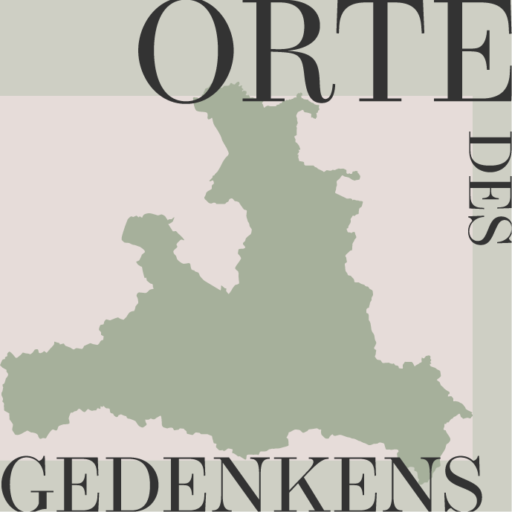80 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs und dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft, erinnern wir an Margarethe Oblasser und alle anderen, die gemeinsam versucht haben das Leben von Karl Rupitsch zu retten.
Margarethe Oblasser wurde am 06. 12. 1912 in Taxenbach geboren. Sie war meine Großtante.
Margarethe Oblasser war bei Kaspar Wind beschäftigt und begleitete den LKW des Alois Buder, mit dem Karl Rupitsch zur Flucht aus St. Johann verholfen wurde, nach Taxenbach. In Taxenbach sollte sich Rupitsch auf dem Hof des Bruders von Margarethe Oblasser, Johann Oblasser, verstecken. Für diese Unterstützungshilfe wurde sie am 11. Juli 1944, verhaftet und ins Polizeigefängnis Salzburg eingeliefert. Neben der Unterstützung von Karl Rupitsch wurde ihr auch verbotenes Radiohören vorgeworfen. Sie wurde von der Gestapo verhört, geschlagen und am 27. August 1944 mit 14 anderen Frauen aus Boden und Umgebung in das Konzentrationslager Ravensbrück eingeliefert. Verhaftet wurden neben zahlreichen Unterstützer*innen aus Boden und Goldegg Weng hier in St. Johann Kaspar Wind, Alois und Theresia Buder, Theresia Steinlechner und Anton Mayr, der Schwager von Gretl Oblasser. Kasper Wind sowie Alois Buder wurden hingerichtet, Theresia Buder überlebte die Strapazen von Verhaftung, Transport und Konzentrationslager nicht.
Am 30.April 1945 wurde das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück von der roten Armee befreit. Im Lager befanden sich etwa 3000 marschunfähige, kranke Frauen. 20 000 Inhaftierte wurden vor Kriegsende in Marschkolonnen Richtung Nordwesten getrieben. Wir wissen nicht, ob Margarethe Oblasser zu den im Lager verbliebenen oder auf Todesmarsch gezwungenen Frauen gehörte.
Im Mai oder Juni 1945 kehrte sie nach St. Johann zurück und heiratete 1946 den Franz Vogl, einen Wehrmachtssoldaten. Bis zu ihrem Tod 2006, wohnte sie in dem Haus an der Bundesstraße, das sie mit ihm errichtet hat.
Wir können es uns nicht vorstellen was es heißt verhaftet und bei Einvernahmen gefoltert zu werden, auf Transport zu gehen, in einem Konzentrationslager inhaftiert zu werden. Auch Margarethe Oblasser konnte dies nicht wissen. Was sie erlebte war ein radikaler, schmerzvoller und anhaltender Bruch in ihrem Leben.
Nach ihrer Rückkehr musste sie wieder Fuß fassen und weiterleben. In einem St. Johann, indem die Verbrechen der Nationalsozialisten geleugnet und verharmlost wurden. Die Ideologie von Verachtung und Vernichtung hatte sich mit Denunziation und Alltagshetze in den Köpfen der Menschen festgesetzt. Täter*innen und Mittäter*innen behielten ihre Positionen und konnten ihre Leben, ohne sich umfassend verantworten zu müssen, weiterführen. Verfolgte des Regimes galten auch nach dessen Kapitulation als Verbrecher*innen, unabhängig davon, dass die Grundlage der Verfolgung menschenverachtend und Unrecht war.
Margarethe Oblasser hat nicht darüber gesprochen, warum sie den Karl Rupitsch unterstützt hat und nicht darüber, was sie in dem Jahr zwischen 9. Juli 1944 und 30. April 1945 erlebt hat. Sie hat ihre Erinnerung verschlossen, um überleben zu können.
Zwei verschiedene Erinnerungsorte waren für sie jedoch von Bedeutung: Jährlich besuchte sie am 2. Juli den Gedenkstein, errichtet von Anna Hochleitner für ihre am 2.Juli 1944 „meuchlings erschossenen“ Söhne Simon und Alois Hochleitner“ und sie hat die Hans-Kappacherstraße in St. Johann niemals betreten. Hans Kappacher war von 1938 – 45 und von 1949 bis 1978 Bürgermeister von St. Johann und wohnte ihrer Verhaftung bei. In einer Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 15.7.1944, wird er wie folgt wiedergegeben: „Der Bürgermeister bringt klar zum Ausdruck, dass für solche Elemente (gemeint sind die verhafteten des Unterstützungswiderstands und damit auch Margarethe Oblasser, E.O.) eine Gefühlsduselei nicht am Platze ist“.
Verfolgung, Verschleppung und Haft gehörten zum Leben meiner Großtante. Es ist ihre Geschichte. Ihr Umgang mit dem Unfassbaren war Schweigen. Auch wenn sie nicht vergessen hat, wollte sie ihre Erfahrung nicht teilen, weil das Erlebte nicht teilbar ist.
Das Schweigen war im Leben von Margarethe Oblasser eine Form der Selbstbestimmung, um den Teil ihrer Geschichte – das Trauma, den Schmerz und die Beschämung – in ihrer persönlichen Bedeutung zu bewahren, sie nicht herzugeben und von anderen deuten zu lassen.
Mit der Verlegung eines Stolpersteins an dem Ort, an dem sie gemeinsam mit anderen versucht hat ein Leben zu retten und damit der Herrschaft der Nationalsozialisten widersprochen hat, wird ihre Verfolgung sichtbar gemacht. Erinnert wird an ein gesellschaftliches System, das seine Macht mit brutalen Methoden durchgesetzt und 17 Millionen Menschen vernichtet hat. Eingemahnt wird, dass wir auch im Jetzt aufgerufen sind, gegen Antisemitismus, Rassismus, Krieg und autoritäre Ideologien aufzustehen.
Margarethe Oblasser, meine Großtante, hat mir sowohl den roten Winkel, Kennzeichnung für politische Gefangene im KZ als auch ein Flugblatt in russischer und deutscher Sprache vererbt, das sie auf ihrem Rückweg aufgelesen hatte. Sie hat mich eingesetzt ihre Geschichte nicht zu vergessen, sondern weiterzutragen. Die Erinnerung an den Unterstützungswiderstand lässt mich erkennen, dass es auch in totalitären Regimen die Entscheidungsfreiheit gibt, andere Menschen und ihre Leben wahrzunehmen und das Selbstverständliche zu tun.
Die Geschichte der Margarethe Oblasser erzählt aber auch davon, wie hoch der Preis sein kann, die eigene Menschlichkeit zu wahren und nicht zuletzt, dass Widerstand nur in Verbindung mit anderen gelingen kann.
Dieses Wissen hilft mir in Zeiten wiedererstarkender menschenfeindlicher Ideologien, Mut aufzubringen und gegen Unrecht einzutreten.
Am Ende meiner Überlegungen möchte ich die Frage an Sie weitergeben, „Was können wir individuell Gutes aus der Geschichte des Unterstützungswiderstandes lernen?“
Elfi Oblasser